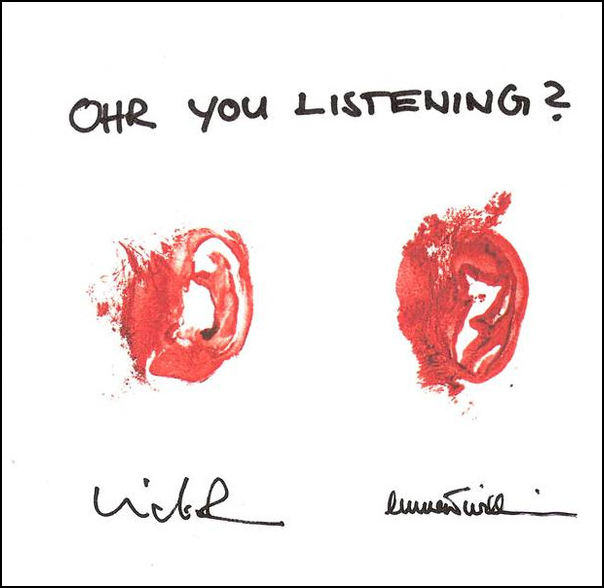Der Friseur des König Midas hat ein Problem: Er muss sich dringend aussprechen. Nur darf niemand wissen, was er sah, als sein Herr zum Haareschneiden den Turban abnahm: Der König hat lange, mit grauen Zotteln behangene Eselsohren. Der verärgerte Gott Apollo hat ihn damit für seinen miserablen Musikgeschmack bestraft. Midas hatte bei einem Sangeswettstreit unter Göttern dem rustikalen Krächzen des Pan den Vorzug vor Apollos Himmelsklängen gegeben. Der Friseur verspürt nun das starke Bedürfnis, sein Geheimnis jemandem anzuvertrauen. Da niemand von der Schande des Königs erfahren soll, läuft der Friseur ans Flussufer, gräbt ein Loch in die Erde und flüstert hinein: „König Midas hat Eselsohren!“ Erleichtert von seiner Seelenpein buddelt er das Loch wieder zu. An dieser Stelle des Ufers wächst nun ein Wald aus Schilfrohr, das, wenn der Wind hindurchstreicht, flüstert: „König Midas hat Eselsohren!“
Wie dem Friseur aus dem Mythos geht es uns allen früher oder später: Wir glauben zu platzen, wenn wir niemandem erzählen können, was uns umtreibt. Der Adressat ist dabei, seien wir ehrlich, nicht wichtig. Am Telefon, im Taxi, auf der Couch graben wir unserem Gegenüber ein Loch in den Kopf und sprechen hinein. Zwar löst das unsere Probleme nicht, aber wir fühlen uns leichter.
Durchlöchert wie einer, der oft geduldig zuhört, ist unser Spiegelbild, das uns aus Victor Kéglis Arbeit „Die Eselsohren des Midas“ aus sechs schwarzen, quadratischen Wasserbecken, mit jeweils einem Meter Seitenlänge, entgegenblickt. Die klagenden Stimmen aus den Lautsprechern, an mannshohen, weißen „Schilf“-Stangen angebracht, meinen sie uns? Die Schilfrohre flüstern einander zu, was den Mühsamen und Beladenen, zu denen wir alle mal gehören, entweicht: das Lebensgeräusch des Jammers und der Klage. Der Wind aus dem Ventilator fährt, von außen kommend, dazwischen, verteilt das Gewisper, vertreibt Gedanken, die sich in den Köpfen festgefressen haben. Er stört das Ritual und sorgt gleichzeitig für frische Luft. Scheinbar unverbunden mit der Symbiose aus Loch und Klage bringt er, was uns in der Bedrängnis am meisten fehlt, Bewegung und Leichtigkeit.
Und geht nicht auch etwas Tröstliches aus von den Stimmen aus den 96 Röhren? So ernst man sie einzeln nehmen kann, im Chor werden sie unweigerlich komisch. Victor Kégli macht sich nicht lustig über sie. Er zeigt, dass das Bedürfnis, sich auszusprechen, menschlich ist; dass unsere Stimme eine unter zahllosen anderen ist, von denen Wind und Schilf erzählen. (Tanja Schwarz)